Mandragora und Alraun in der deutschen Wissenschaft und Literatur
ebook ∣ Am Beispiel Grimmelshausen und Jacob Grimm · Beihefte Zu Simpliciana
By Peter Hesselmann
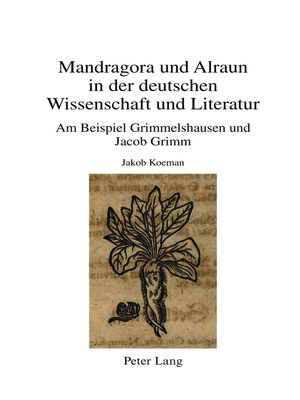
Sign up to save your library
With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.
Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.



Search for a digital library with this title
Title found at these libraries:
| Library Name | Distance |
|---|---|
| Loading... |
Die vorliegende Studie bietet einen kompakten Überblick über die historische Entwicklung und (pseudo)wissenschaftliche Beschreibung des Stoffkomplexes Dudaim ‒ Mandragora ‒ Alraun ‒ Galgenmännlein von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die „Mandragora" ist die Pflanze Gemeine Alraune bzw. Mandragora officinarum (Linnaeus); der „Alraun" seit dem späten Mittelalter die Bezeichnung für die anthropomorphe Wurzel dieser Pflanze, die seit der Barockzeit auch „Galgenmännlein" oder „Galgenmännchen" genannt wird. Die Verwendung beider Bezeichnungen im Buchtitel bringt die Entwicklung vom urzeitlichen, hebräischen und griechisch-römischen Dudaim- bzw. Mandragora-Mythos zur abendländischen, im späten Mittelalter entstandenen und in der Frühen Neuzeit und auch nachher im deutschen Sprachraum weit verbreiteten Alraun-Sage sowie dem damit zusammenhängenden Alraunaberglauben zum Ausdruck. In den Hauptkapiteln werden die Alraun-Passagen in Werken von Johannes Praetorius, Johann Rist, Johann Jacob Christoffel von Grimmelshausen und Jacob Grimm erörtert.







